Seminare
Es werden die folgenden Seminare angeboten:
- A 1 / Noch unberührt – Religion und Jungfräulichkeit. Annäherungen an ein christliches Leitideal
- A 2 / Lebenswelten junger amerikanischer Christ*innen
- A 3 / Schmelztiegel Religion. Vielfalt, Politik und Gesellschaft in Lateinamerika
- A 4 / Endzeitstimmung, Transformation und Hoffnung – hilft Theologie in der Klimakrise?
- A5 / Kirche, wie lange noch: ein Blick in die Zukunft der Kirche
A 1 / Noch unberührt – Religion und Jungfräulichkeit. Annäherungen an ein christliches Leitideal
Jungfräulichkeit ist als eines der zentralen Leitideale des Christentums in Antike und Mittelalter bis in die Neuzeit hinein tief in die DNA des heutigen Christentums eingeschrieben. Bis heute prägen Vorstellungen von (kultischer) Reinheit, Körper, Sexualität und Heiligkeit Theologie und religiöse Praxis. Außerhalb des Christentums hat Jungfräulichkeit im weitesten Sinne in den letzten Jahren in Deutschland für negative Schlagzeilen und einen sehr von Angst, Unmut und Abgrenzung geprägten gesellschaftlichen Diskurs gesorgt. Mit dem Erscheinen des biographischen Romans »Unorthodox« (Deborah Feldman) 2017 und der Adaption als Netflix-Miniserie 2020 geriet eine jüdisch-orthodoxe Gemeinde in den Blick, in der Jungfräulichkeit, Keuschheit, Geschlechtertrennung im 21. Jahrhundert eine große Rolle spielt – und löst hoch kontroverse Diskurse aus. Die Machtübernahme der Taliban im August 2021 in Afghanistan und die Proteste nach dem Tod Mahsa Aminis im September 2022 im Iran lösten weltweite Proteste aus, in denen Sexualität, Selbstbestimmung und Geschlechtergerechtigkeit in einzelnen islamischen Gruppen eine große Rolle spielten.
Welche Rolle spielen Ideale von Keuschheit, Jungfräulichkeit in Theologien und Praxen von vielgestaltigem Judentum und Islam heute?
Im Christentum werden Konzepte von Keuschheit, Jungfräulichkeit und Reinheit in den letzten Jahren wieder sichtbarer.
Nach einer Verdrängung des ehemaligen Leitideals taucht es in den verschiedensten Spielarten wieder auf (Theologie des Leibes, Ordensspiritualität, purity movement, u. v. m.). Von Ablehnung und Unverständnis geprägte Diskurse in Deutschland löste das sogenannte purity movement in den USA aus, welches christlich-religiös motivierte Jungfräulichkeit bis zur Ehe in den Mittelpunkt des religiösen Lebens stellt. Auch die Auseinandersetzungen der katholischen und evangelischen Kirchen mit sexuellem und geistlichem Missbrauch bringen die genannten Themen wieder aufs gesellschaftliche und kirchliche Tableau. Im Seminar wollen wir uns dem Ideal der Jungfräulichkeit aus historischtheologischer Perspektive annähern. Anhand von ausgewähltem Quellenmaterial aus Antike, Mittelalter und Früher Neuzeit erarbeiten wir das christliche Leitideal, seine theologischen Begründungsfiguren, diejenigen, die es leben, und diejenigen, die es propagieren. In der zweiten Hälfte des Seminars werden wir uns exemplarisch mit heutigen theologischen Ansätzen und Praktiken in Judentum, Islam und Christentum beschäftigen, um zu diskutieren, ob und inwiefern ein solches Ideal heute verantwortbar sein kann.
Dauer: 5 Tage
Zeitraum: 29.Juli - 2. August 2024
Veranstaltungsort: Odenthal
Seminarleitung: Sr. Jakoba Zöll
A 2 / Lebenswelten junger amerikanischer Christ*innen
Man hört und liest in Deutschland derzeit viel von ihnen: junge amerikanische Christ*innen, die den Spagat schaffen müssen zwischen einem Leben in der modernen Welt und den konservativen, traditionellen Werten, die in ihrer Glaubensgemeinschaft gelebt werden. Was bewegt diese Menschen? Wie stellen sie selbst ihre Lebenswelt(en) dar? Berichte, die den Weg nach Deutschland finden, sind möglicherweise nur ein Teil der komplexen Wahrheit. Ebenfalls stellt sich die Frage, welche Einflüsse es auf die Entwicklung hat, in einem hochreligiösen – und damit vielleicht eher restriktiven – Kontext aufzuwachsen. Ist es möglich, auch innerhalb des eigenen Glaubenssystems zu »wachsen«? Und was ist, wenn die Glaubenssätze, mit denen man aufgewachsen ist, mit der Zeit nicht mehr passend erscheinen? Dem Thema Dekonversion, also der Abkehr vom Glauben, soll in diesem Kontext genauso Aufmerksamkeit geschenkt werden wie der Frage, warum eine (mehr oder weniger streng) religiöse Gemeinschaft attraktiv sein kann für junge Menschen und welche positiven Effekte hier zu beobachten sind. Interessant ist auch die Frage, wie sich die gelebten Realitäten in Deutschland und den USA unterscheiden. Die religiösen Landschaften in den zwei Ländern sind sehr unterschiedlich und entsprechend kann es etwas ganz anderes bedeuten, in den USA sich beispielsweise zum Atheismus zu bekennen, als das in Deutschland der Fall ist. Das deutsch-amerikanische Forschungsprojekt »Religiöse Entwicklung über die Lebensspanne« der Universitäten in Bielefeld und Chattanooga, TN, widmet sich diesen und anderen Fragen seit über 20 Jahren. Hauptinstrument ist hier das Faith Development Interview, ein Interviewleitfaden, der mit seinen 25 Fragen dazu einlädt, ausführlich über wortwörtlich Gott und die Welt nachzudenken, aber auch über das eigene Leben, Beziehungen und Moralvorstellungen. Über die Jahre entstand hier eine große Sammlung an spannenden Lebensgeschichten (zum Teil im Längsschnitt mit bis zu vier Interviews von einer Person), von denen einige als Fallstudien den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt werden.
Der methodische Fokus liegt auf der qualitativen Analyse des Interviewmaterials, unser fachlicher Hintergrund ist divers mit einem Schwerpunkt auf Entwicklungs- und Sozialpsychologie, aber auch Elementen aus der Linguistik und Theologie.
Das Seminar möchte den oben skizzierten Fragen in einem bilingualen Setting nachgehen. Die Teilnehmenden können von den unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen der deutschen und amerikanischen Lehrpersonen profitieren und so tiefgehende Einblicke in dieses interessante Themenfeld erlangen. Unterrichtssprachen (und die vorbereitende Lektüre) werden demnach Englisch und Deutsch sein, wobei es immer die Gelegenheit geben wird, Nachfragen auch auf Deutsch zu stellen.
Seminarleitung: Dr. Ramona Bullik, William Andrews
Veranstaltungsort: Freiburg
Zeitraum: 4. - 8. März 2024
Dauer: 5 Tage
A 3 / Schmelztiegel Religion. Vielfalt, Politik und Gesellschaft in Lateinamerika
Das gegenwärtige Lateinamerika ist eine Hochburg religiöser Vielfalt. Katholizismus, charismatisch-evangelikale Bewegungen und indigene Religionen haben mit ihren unterschiedlichen historischen Entwicklungen, Theologien und Glaubenspraktiken den Kontinent geprägt. Religion ist ein zentraler Player im gesellschaftlichen Leben und in der Politik. Zentrale Themen in Lateinamerika sind zum Beispiel die Zunahme der politischen Macht von rechtspopulistischen Parteien in vielen Ländern in Lateinamerika und der Kampf um den Amazonas-Regenwald zwischen Regierungen und Indigenen Bevölkerungsgruppen. Diese Entwicklungen können nicht ohne den Einbezug von Religion verstanden werden. Am Beispiel des Katholizismus lässt sich aufzeigen, wie sich das aus der spanischen Kolonialisierung und Mission kommende Christentum in Lateinamerika transkulturiert hat. Das zeigt sich nicht nur in der Befreiungstheologie, sondern auch in unterschiedlichen Verflechtungen von katholischen und indigenen Traditionen. Charismatisch-evangelikale Bewegungen erfahren das größte Wachstum. Viele Politiker*innen in Lateinamerika gehören der Bewegung an, wodurch es zu einer Verflechtung zwischen pentekostalen bzw. charismatischen Kirchen und rechtsorientierten Parteien kommt. Indigenes Wissen wird zunehmend auch für junge nichtindigene Menschen attraktiv, weil es Antworten auf die Frage nach ökologischer Gerechtigkeit liefern kann. Die Beziehung zwischen indigenen Religionen und dem Christentum ist ambivalent.
Gemeinsam wollen wir in dem Seminar den Einfluss von Religionen auf Politik und Gesellschaft in Lateinamerika nachvollziehen und gegenwärtige Entwicklungen sowie mögliche Handlungsstrategien diskutieren. Die theoretische Basis werden postkoloniale, dekoloniale und transkulturelle Theorien sein. Der Fokus wird auf ganz konkreten interkulturell-theologischen Beispielen liegen, an denen die Thematik entfaltet werden kann. Das Thema werden wir mit interaktiven und vielfältigen Methoden bearbeiten. Es werden Bilder, Objekte und Medientechnologien eingesetzt. Außerdem werden Diskussionen im Plenum und in kleinen Gruppen gefördert. Lateinamerikanische Sozial- und Religionsexpert*innen werden digital dazu geschaltet und teilen ihre Erkenntnisse und Perspektiven.
Seminarleitung: Alena Höfer, Daniel Jara Jhayya
Veranstaltungsort: Haus Villigst
Zeitraum: 12. - 17. August 2023
Dauer: 6 Tage
A 4 / Endzeitstimmung, Transformation und Hoffnung – hilft Theologie in der Klimakrise?
Die Klimakrise ist auch in Deutschland spürbar und es wird medienwirksam über ihr Verständnis sowie über zu treffende Maßnahmen in Politik, Familien, Kirchengemeinden und vielen anderen Orten debattiert. Klimakrise – das ist für die einen ein existenzielles Thema und andere scheint es nichts anzugehen oder sie fühlen sich davon provoziert. Auch in Theologie und Kirche sind Fragen der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes nicht erst seit der Klimaschutzrichtlinie des letzten Jahres handlungsleitend – und in ihrer theologischen Einordnung und Deutung umstritten. In diesem Kurs geht es darum, die Teilnehmer*innen dazu zu befähigen, sich in dem theologischen Diskurs zu orientieren, eine begründete eigene Position zu finden sowie argumentativ zu vertreten. Dabei leiten uns vor allem die folgenden Fragen: Wie können wir noch von Herrschaftsauftrag, Umwelt und »guter« Schöpfung sprechen? Wie sind Natur und die Wendung guter »Bewahrung der Schöpfung« zu verstehen? Ist Ökotheologie spirituell begründet? Wo und wie sind das Verständnis der Welt als Mitwelt und die Rolle des Menschen in der Bearbeitung der Klimakrise und im Umgang mit den Mitgeschöpfen zu bestimmen? Wir beginnen am Anreisetag mit einer selbstreflexiven Verortung zu Schöpfungs- und Umweltfragen. An unserem ersten Arbeitstag führen wir in die theologischen Grundlagen ein und klären relevante Begriffe wie »Schöpfung«, »Geschöpf« und »Umwelt«, die gar nicht so eindeutig sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Hier steht auch die Frage im Raum, inwiefern die Klimakrise überhaupt auch ein Thema der Theologie, von Religione n/ Spiritualitäten und des persönlichen Glaubens ist. Darauf aufbauend, folgt am zweiten Arbeitstag eine theologische Betrachtung der Um- bzw. Mitwelt.
In Diskussionsrunden und Einzelarbeitsphasen erkunden wir die Vor- und Nachteile verschiedener Verständnisse und setzen sie mit unseren eigenen mitgebrachten Vorstellungen in Verbindung. Lässt sich eine »ökologische Widerstandstheologie« entwickeln oder ist diese aus guten Gründen abzulehnen? Der dritte Arbeitstag widmet sich ethischen Orientierungen und Positionierungen. Wir nutzen verschiedene ethische Grundmodelle und -begriffe, um Positionen nachzuvollziehen und zu kritisieren, aber auch um eine eigene entfalten zu können. Gemeinsam entwickeln wir mögliche, dezidiert theologisch begründete Richtlinien und Szenarien für (christlich) begründetes Handeln in der Klimakrise. Das für ethische Debatten so wichtige Argumentieren üben wir u. a. in einem Rollenspiel ein, in dem auch die Auseinandersetzung mit Klimawandelleugner*innen erprobt werden kann.
Am Abreisetag schließlich nehmen wir unsere selbstreflexive Verortung vom Anfang auf und fragen uns, ob und, wenn ja, was sich in den letzten Tagen bei uns geändert hat.
Als besondere Abendveranstaltungen sind ein (angeleitetes) spirituelles Eintauchen in die Schöpfungsthematik und ein Austausch mit Klimaaktivist* innen vorgesehen.
Seminarleitung: Dr. Lea Chilian, Dr. Kinga Zeller
Seminarort: Wittenberg
Zeitraum: 16. - 20. September
Dauer: 5 Tage
A 5 / Kirche, wie lange noch: ein Blick in die Zukunft der Kirche
Das kommende Jahr markiert einen gesellschaftlichen Wendepunkt: Ab 2024 wird die Mehrheit der in Deutschland lebenden Menschen keiner der beiden großen christlichen Kirchen mehr angehören. Weitere Prognosen sagen voraus, dass die EKD im Jahr 2060 nur noch 10,5 Millionen Mitglieder hat, die Kirchensteuerkraft wird sich um die Hälfte reduzieren. Von diesen Vorhersagen ausgehend, beschäftigt sich das Seminar mit der jetzigen und der noch kommenden Gestalt von Kirche: Wie ist die Evangelische Kirche in Deutschland derzeit strukturell und finanziell aufgestellt? Welche kirchlichen Formate wird es in Zukunft (noch) geben? Im Seminar muss daher zunächst die Frage verhandelt werden, was › Kirche‹ eigentlich genau ist. Ist die Organisation Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) von der Institution Kirche zu trennen? Welche Schnittmengen ergeben sich? Dabei wird die EKD kirchentheoretisch und organisationssoziologisch in den Blick genommen und mit anderen Formen institutionalisierter (protestantischer) Frömmigkeit verglichen. Ein weiterer Teil des Seminars ist den Kirchenmitgliedern gewidmet. Wie nehmen sie die Ortsgemeinde, ihre Pfarrer*innen und Ehrenamtlichen wahr, was erwarten sie von ihrer Kirche? Wer sind »die« Kirchenmitglieder genau? Wen sprechen traditionelle kirchliche Formate an und wen nicht?
Mit Hilfe von Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen und Interviewauszügen wollen wir uns den Erwartungen und Einstellungen der evangelischen Kirchenmitglieder nähern. In Deutschland werden die beiden großen Kirchen maßgeblich durch die Kirchensteuer sowie staatliche Zuschüsse finanziert. Die Finanzierung der Kirche sowie die finanzielle Entwicklung werden somit ebenfalls Thema des Seminars sein. Da dieses Modell im internationalen Vergleich eher ungewöhnlich ist, wollen wir mit Kirchenvertreter*innen aus anderen Ländern ins Gespräch kommen, um uns vor diesem Hintergrund dann mit alternativen Kirchen- und Gemeindeformen, z. B. Fresh X, zu beschäftigen.
Denn bei der Behandlung des Istzustands der Kirche darf ein Blick in die Zukunft nicht fehlen: Wie werden sich Religiosität und die institutionell verfasste Religion entwickeln? Welche gesellschaftliche Rolle kann die Kirche der Zukunft spielen? Welche Formate bieten sich an, den Mitgliederschwund der EKD zu verlangsamen. Und: Sollten wir das überhaupt?
Methodisch stützt sich das Seminar auf vorzubereitende Lektüre sowie auf die Bereitschaft der Teilnehmenden, ggf. kleine inhaltliche Impulse vorzubereiten.
Seminarleitung: Dr. Franziska Schade
Seminarort: Freiburg
Zeitraum: 4. - 8. März 2024
Dauer: 5 Tage

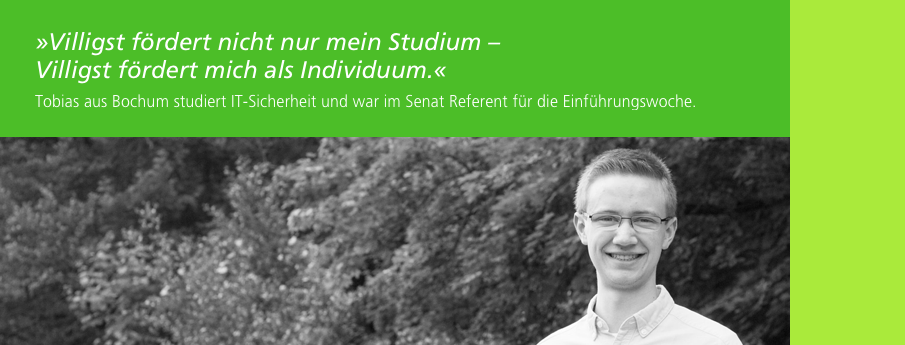
 Gefördert durch die:
Gefördert durch die:
